
Justiz Hammer Waage Gericht
Ein Gastbeitrag von RA Prof. Dr. Andreas Gran, LL.M. 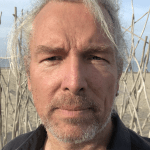
1. Einleitung
Angesichts mehrerer Herausforderungen in der jüngeren Vergangenheit, haben sich Fragen zur Handhabe des modernen deutschen Rechtsstaates ergeben, um gegen Gefährdungen – ggf. sogar prophylaktisch – vorzugehen. Anlässe für die Diskussionen bieten u. a. die „Letzte Generation“, die „Gruppe um Lina E“, die „Querdenker“ und die „Reichsbürger“. Es geht jeweils darum, einerseits Staatsgewalt (wohlwollend) zu nutzen, um Wirtschaft und Gesellschaft zu schützen, aber andererseits die dem Staat selbst gesetzten Grenzen einzuhalten, um der latenten Gefahr des Machtmissbrauchs sowie staatlicher Willkür vorzubeugen und Tendenzen zu erkennen. Trotz subjektivem Schutzbedürfnis, persönlicher Betroffenheit und emotionaler öffentlicher Diskussion darf nämlich nie in Vergessenheit geraten, wie sich ein Staat verändern kann, wenn dessen Eingriffsrechte mehr und mehr unkontrolliert ausgeweitet werden. Dass dies stets mit dem Argument der Wahrnehmung eines staatlichen Fürsorgeauftrages legitimiert werden soll, zeigen Erfahrungen aus unserer Gesichte und dem Ausland.
Nachfolgend wird dazu mit Bezugnahmen auf die geltende – oft mit subjektiven Einschätzungen einhergehende – Rechtslage erläutert, welches verfassungsrechtliche Dilemma sich derzeit verstärkt offenbart. Insoweit skizziert der Beitrag die konkreten Vorgaben in Gesetzen und Verordnungen hinsichtlich einzelner Maßnahmen bezüglich Vorbeugehaft, krimineller Vereinigung, Demonstrationsverbot und Razzien. Nicht das Vorgeben einer politischen Meinung dazu steht im Fokus, sondern das Sensibilisieren für die Funktionsweise der Rechtsgemeinschaft anhand von pädagogisch und didaktisch geeigneten Beispielen. Mit Spielraum für persönliche Meinungsbildung wird der Beitrag abgeschlossen durch den Denkanstoß, ob staatliche Eingriffe jeweils noch kritischer zu hinterfragen sind, wenn zumindest das Motiv derjenigen, gegen die vorgegangen wird, mit moralischen Werten unserer Gesellschaft vereinbar ist.
2. Verfassungsrechtlicher Hintergrund
An dieser Stelle ist klarstellend hervorzuheben, dass der Begriff „Staat“ als solcher angesichts zahlreicher Fehlentwicklungen in der Welt und in der Geschichte – vorsichtig ausgedrückt – nicht uneingeschränkt positiv besetzt ist. In Kombination mit dem Begriff „Gewalt“ stößt dies nachvollziehbar auf skeptische Betrachtung in der Öffentlichkeit. Tatsächlich zeigt die deutsche Vergangenheit, wie Staatsgewalt ausgenutzt werden kann, um politische Gegner zu bekämpfen und eine Autokratie aufzubauen. Bereits dem Wesen nach ist dabei riskant, dass Gewalt als Ausdruck von Autorität erscheinen kann. Der demokratische Rechtsstaat in der Bundesrepublik Deutschland soll auf den Vorgaben des Grundgesetzes fußen. Dieses sieht in Folge deutscher Geschichte die „Gewaltenteilung“ als wesentlich an. Die gesetzgebende Gewalt (Legislative, u. a. Bundestag) setzt den kodifizierten Rechtsrahmen, die ausführende Gewalt (Exekutive, u. a. Polizei) agiert auf dieser Grundlage und die rechtsprechende Gewalt (Judikative, u. a. Verwaltungsgerichte) bietet der Bevölkerung die Möglichkeit der Machtkontrolle. Konkret wird in unserer Verfassung ferner hervorgehoben, dass „alle Macht vom Volke ausgehe“ und die „Würde des Menschen unantastbar“ sei (Artikel 1 GG). Vor diesem Hintergrund ist unsere Verfassung Grundlage für Eingriffe in die individuellen Freiheitsrechte. Insbesondere ermöglicht sie den sog. Sicherheits- und Gefahrenabwehrbehörden – denen das „Gewaltmonopol“ zugedacht ist – die Verletzung der Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern nur bei Vorliegen sog. Ermächtigungsgrundlagen. Gerechtfertigt wird dies mit dem staatlichen Fürsorgeauftrag, der sich ebenfalls aus der Verfassung herleiten lässt. Beides kollidiert naturgemäß und ist Gegenstand anhaltender staats- und verwaltungsrechtlicher Diskussionen.
3. Latente Gefahr autokratischer Einflüsse
Jede demokratische Staatsform ist latent gefährdet, durch eine Autokratie ersetzt zu werden, weil dort Schutzauftrag und Machtanspruch aufeinanderprallen. Unsere Demokratie ist – trotz aller Abwehrversuche und gewiss wohlwollender Grundlage – ebenfalls gefährdet. Der jüngeren Generation mag dies noch weniger bewusst sein, als deren Eltern und Großeltern, denn Erinnerungen an Machtmissbrauch verblassen. Die Gefahr ergibt sich dadurch, dass autokratische Strömungen versuchen können, auf demokratischem Weg an die Macht zu gelangen und dies dann durch Aufgabe demokratischer Abwahlmöglichkeiten und Verhinderung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Opposition zu verfestigen. Umso wichtiger ist es, den Drang zur Autokratie frühzeitig zu erkennen. Insbesondere wenn die Exekutive nicht mehr hinreichend durch die Judikative überprüft werden kann. In diesem Zusammenhang sei ergänzt, dass nach unserer Verfassung nicht jedweder Staat gewollt ist, sondern eben nur der freiheitlich demokratisch gewählte Staat, dessen Regierung die eigene Abwahl ebenso zulassen muss, wie andere politische Meinungen. In der freiheitlich demokratischen Grundordnung ist es sogar erklärtes Ziel, totalitäre Bestrebungen zu unterbinden, um die demokratische Gesellschaftsordnung zu schützen.
Artikel 20 Abs. 4 GG lautet: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“ Es ist also ein privates Gewaltrecht in Ergänzung zum staatlichen Gewaltmonopol vorgesehen, auch gegen eine etwaige Staatsgewalt, sollte sich diese von der freiheitlich demokratischen Grundordnung entfernen. Hier ist also eine differenzierte Betrachtung geboten, aber das jeder – sogar einer auf freie, soziale und menschenwürdige Werte ausgerichteten – staatlichen Macht innewohnende Risiko des staatsverändernden Machtmissbrauchs darf auch in unserer Staatsform nicht aus dem Blick geraten.
Ob pauschal jegliche „Befreiung der Gesellschaft vom Staat“ zu verlangen ist, wie sie der kommunistische Anarchist Erich Mühsam im aufkommenden Faschismus – vor seiner Tötung – in Sorge bei zunehmendem Machtmissbrauch forderte, muss bezweifelt werden. Jegliche komplexe Gesellschaft wird nämlich gewisse institutionelle Organisationsstrukturen erfordern, mag diese durch Räte, Plenum oder sonstige Strukturen erreicht werden. Wichtig ist jedoch stets, dass Macht effektiv kontrolliert wird und genau darum soll es bei den folgenden aktuellen Herausforderungen gehen.
4. Aktuelle rechtsstaatliche Herausforderungen
Um das Dilemma vor Augen zu führen, werden mehrere konkrete Entwicklungen in Bezug gesetzt, bei denen sich einheitlich die Frage ergibt, wie Gefahren „rechtzeitig“ entgegenzutreten ist. Dabei sei angemerkt, dass sich diese Entwicklungen hinsichtlich Bedrohungspotenzial, aber insbesondere auch hinsichtlich der dahinter stehenden Motivation, deutlich unterscheiden und nur angesichts der hier interessierenden Thematik in einen Zusammenhang zu setzen sind.
Die „Letzte Generation“ ist eine Gruppe von sog. Klimaaktivisten, deren Mitglieder durch mehrere Gesetzesüberschreitungen Öffentlichkeit erreicht und zugleich den Rechtsstaat vor eine Herausforderung gestellt haben. Sie haben durch Blockaden von Verkehrswegen und Flughafeninfrastruktur den Verkehrsfluss behindert, um die Verkehrspolitik als solche kritisch zu hinterfragen. Als Form des sog. zivilen Ungehorsams wurden und werden weitere Aktionen durchgeführt. Bezeichnend ist dabei, dass deren verfolgtes Ziel als solches, nämlich der Schutz vor dem Klimawandel, weitgehend gesellschaftlich und politisch geteilt wird und sogar Teil des Regierungsprogramms ist.
Gleichwohl finden die Maßnahmen als solche weitgehend keine Akzeptanz in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Demgegenüber berufen sich diese Klimaschützer auf das übergeordnete Recht zu Eingriffen, wenn der Staat selbst es versäumt, die Bevölkerung zu schützen. Besonders markant waren die Widerstände anlässlich der Besetzung und Räumung des Ortes Lützerath, die von einer Großdemonstration mit vermeintlich mehr als 30.000 Teilnehmern begleitet wurden. Diese Ausgangslage erinnert einerseits an die Widerstände von Atomkraftgegnern in Wackersdorf Mitte der achtziger Jahre sowie an die außerparlamentarische Opposition (APO) und die sog. Hausbesetzerszene, die jeweils erhebliche politische Veränderungen bewirken konnten. Bei diesen Betrachtungen zeigt sich, dass bei der Verfolgung solidarischer Ziele besondere Herausforderungen bestehen, wenn staatliche Organe gleichwohl die Formen des zivilen Ungehorsams nicht hinnehmen. Gegenstand der rechtlichen Diskussionen sind „Vorbeugehaft“, „kriminelle Vereinigung“, „Einschränkung von Versammlungsfreiheit“ und „Razzien“.
Weniger bekannt ist die Entwicklung hinsichtlich der Aktivistin Lina E aus Leipzig, die vor mehr als zwei Jahren inhaftiert wurde und Mitangeklagte in einem Strafverfahren ist. Ihr und weiteren Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, durch Angriffe auf Personen, welche als rechtsextrem von den Aktivisten angesehen wurden, schwere Körperverletzungen usw. begangen zu haben. Konkret wird untersucht, ob und wie die Gruppe Mitgliedern der sog. rechten Szene beobachtet und angegriffen hatte. Insoweit wird gerichtlich aufgearbeitet, ob eine Form der sog. Selbstjustiz organisatorische Formen angenommen hat. Betrachtet wird beispielsweise, ob Beteiligte Einsätze beim sog. Straßenkampf geübt hätten. Der gesamte Vorgang dient gleichwohl als Beispiel für das Anliegen des Staates, Organisationsstrukturen zu unterbinden, die geeignet sind, politische Ziele eigenständig gewaltsam durchzusetzen. Auch hier ist das Ziel, einer Stärkung der rechtsextremen Szene entgegenzutreten, ein in weiten Teilen der Bevölkerung geteiltes Anliegen. Die ideologische Rechtfertigung entspringt ebenfalls dem Gefühl der Rechtfertigung des Handelns angesichts staatlicher Untätigkeit. Dennoch geht es insbesondere darum, dass das Gewaltmonopol des Staates nicht durch Gewaltbereitschaft Einzelner infrage gestellt werden soll. Die geschichtliche Entwicklung zeigt, wie sich eine solche Polarisierung einer Rechtsordnung entziehen kann, denn beim aufkommenden Faschismus konnte die junge Weimarer Republik dem gewaltsamen Aufeinanderprallen der SA und der sog. Freikorps auf die vorwiegend kommunistischen und teils anarchistischen Aktivisten nicht wirkungsvoll begegnen. Im Ergebnis endete die Demokratie. Nicht zuletzt vor diesem geschichtlichen Hintergrund werden im Zusammenhang mit der Gruppe um Lina E ebenfalls die Themen „kriminelle Vereinigung“ und „Razzien“ rechtlich erörtert.
Bekanntermaßen hatte der Rechtsstaat zudem im Umgang mit den sog. Querdenkern erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Diese ergeben sich vornehmlich daraus, dass in diesem Umfeld gezielt versucht wurde, den sozialen Frieden zu stören. Dass dies nicht für sämtliche Kritikern der sog. Corona-Maßnahmen gilt, deren Anliegen nicht das gezielte Destabilisieren der Demokratie gewesen ist, sei der Vollständigkeit halber erwähnt. An dieser Stelle soll zudem unkommentiert bleiben, inwieweit die Maßnahmen der Exekutive – die oftmals mittlerweile von der Judikative als rechtswidrig erkannt wurden – geeignet, erforderlich und angemessen waren und ob das Ermessen stets rechtmäßig ausgeübt wurde. Im Ergebnis zeigten sich unterschiedliche Auffassungen über die Zulässigkeit staatlicher Eingriffe, da es faktisch nicht möglich war, gegen verfassungsfeindliche sog.Querdenker vorzugehen, ohne zugleich dem Anliegen damit nicht verbundener Bürger*innen entgegenzuwirken. Bei dieser Form der Massenbewegung zeigte sich also, dass Staatsgewalt, wenn sie sich gegen Einzelne in größeren Gruppen richtet, differenziert zu bewerten ist. Es stellten sich rechtliche Fragen, insbesondere bei Eingriffen in die grundgesetzlich garantierte Versammlungsfreiheit.
Mit ganz anderer Interessenlage haben die „Reichsbürger“ und in deren Bedrohungspotenzial massiver den Rechtsstaat herausgefordert. Dort ist erklärtermaßen die Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung das Ziel zugunsten einer völkisch, aristokratisch geprägten Führung. Während also die grundsätzlichen Ziele der „Klimaaktivisten“ und der Aktivisten gegen Rassismus als solche mit den Regierungszielen im Einklang sind, aber die Maßnahmen missbilligt werden, findet sich bei den sogennten Reichsbürgern sowohl hinsichtlich Motivation, als auch hinsichtlich Umsetzung keine Verträglichkeit mit der deutschen Verfassung. Infolge von Durchsuchungen sollen sich Nachweise für konkrete Bestrebungen zu einem Staatsstreich ergeben haben. Demnach haben u. a. Personen mit Kontakt zum Militär versucht, gewalttätig eine neue Staatsform durchzusetzen. Dass gegen derartige Bestrebungen nach Art. 20 Abs. 4 GG sogar Selbsthilfe der Bevölkerung zulässig wäre, unterscheidet dieses Beispiel ebenfalls von den anderen. Aus rechtlicher Sicht bietet sich insoweit eine Betrachtung der „Razzien“ an.
5. Staatliche Handhabe zur Gefahrenabwehr
Bei den vorab skizzierten mutmaßlichen Taten sind haftungsrechtliche Folgen und/oder strafrechtliche Konsequenzen naheliegend, welche der Rechtsfindung durch die Gerichte vorbehalten bleiben müssen. Das deutsche Straf- und Haftungsrecht umfasst (selbstverständlich) bereits diverse Normen, um Derartiges zu sanktionieren: §§ 823 I, II, 826 BGB bestimmen die Haftungspflicht. § 315 b StGB begründet Strafbarkeit bei gefährlichen Eingriffen, wobei allerdings Leib, Leben und Eigentum erheblich bedroht sein müssen. § 240 StGB stellt die Nötigung unter Strafe. In Betracht käme auch § 115 StGB bei konkreter Behinderung von Hilfeleistenden Personen. Demgegenüber könnte § 32 StGB in engen Grenzen eine Notwehr von Betroffenen ermöglichen.
Bei der hier im Zentrum stehenden Thematik ist aber vorrangig zu betrachten, welche Ermächtigungsgrundlagen die Exekutive hat, um bereits frühzeitig antizipierten Gefahren entgegenzuwirken, aber zugleich den von der Legislative gesetzten Rahmen nicht zu verlassen.
Hierzu gilt Folgendes aus rechtlicher Sicht: Die Ermächtigungsgrundlagen der Polizei ergeben sich aus sog. Sicherheits- und Ordnungsgesetzen. Dies obliegt hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung im Föderalismus den Bundesländern. Demnach sind „geeignete, erforderliche und angemessene“ Maßnahmen bei einer (ersichtlichen) „Gefahr“ nach sog. billigem Ermessen umzusetzen. Konkret ermächtigt u. a. § 1 III HSOG (bezüglich Hessen) zu solchen staatlichen Eingriffen zum Schutz privater Rechte durch Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden, aber nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nur, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und, wenn andernfalls ein geschütztes Recht verletzt würde. Die Wörter „nur“ sowie „und“ sind hier von besonderer juristischer Bedeutung. Sie waren bei der Gesetzgebung vor dem Hintergrund unserer Verfassung wohlüberlegt. Ziel des Grundgesetzes ist nämlich nicht nur die Wahrnehmung des staatlichen Fürsorgeauftrages zur Sicherung, sondern auch, Grenzen zu setzen, damit sich willkürliche Machtmaßnahmen unterbleiben. Basierend auf vorstehender Beschreibung der Herausforderungen sollen nun die staatlichen Maßnahmen erläutert werden, wie sie aktuell in die Diskussion einfließen.
5.1 Vorbeugehaft
Mittlerweile forderte aber nun die Polizeigewerkschaft bezogen auf die „Letzte Generation“, sog. Vorbeugehaft leichter umsetzen zu dürfen. Jedoch besteht die Möglichkeit bereits. Für Viele, die um die Einhaltung von Regeln zum Funktionieren der Gesellschaft bemüht sind, erscheint dieses Anliegen emotional verständlich. Dabei darf aber nicht aus den Augen verloren werden, welche Ausuferungen sich ergeben können, denn der Begriff „Vorbeugehaft“ führte in der deutschen Vergangenheit zu willkürlichen Maßnahmen der Strafverfolgungsorgane, auch gegenüber politisch Andersdenkenden. Im deutschen Faschismus wurde intensiv versucht, Taten bereits vorab zu antizipieren und quasi noch vor Begehung zu sanktionieren. Hier gilt es deshalb in besonderem Maße, den Grundsatz der Gewaltenteilung auch angesichts der akuten Angriffe gegen den Rechtsstaat durch Aktivisten gleichwohl strikt einzuhalten: Danach darf die rechtsprechende Gewalt – die Judikative – nicht von der ausführenden Staatsgewalt – der Exekutive – ignoriert werden. Dort fehlt es oft schlicht an der rechtswissenschaftlichen Ausbildung, um die Tragweite der Maßnahmen einzuschätzen. Deshalb ist die gesetzgebende Gewalt angehalten, keine solchen Ermächtigungen zu gestatten und damit den Kern unserer freiheitlich demokratischen Rechtsordnung infrage zu stellen. Es wäre nichts gewonnen, wenn der Rechtsstaat zur prophylaktischen Abwehr Maßnahmen zuließe, die ihn selbst infrage stellen. Bei alledem sollte bei der Forderung nach Vorbeugehaft neben der von Schutzinteressen verständlicherweise getriebenen Argumentation wesentlicher Gegenstand der gesellschaftlichen und politischen Diskussion sein, wie der niemals zu unterschätzenden Gefahr von staatlichem Machtmissbrauch vorbeugend begegnet werden muss.
5.2 Einstufung als kriminelle Vereinigung
Der Begriff der „kriminellen Vereinigung“ hat erheblichen Einfluss auf die Handhabe des Staates. Konkret ist diesbezüglich § 219 StGB hervorzuheben. Daraus ergibt sich auch insoweit eine hohe Sensibilität, was die latente Gefahr staatlicher Willkür anbelangt. Konkret führt die Einstufung einer Gruppe als kriminelle Vereinigung zu einer deutlichen Ausweitung von Eingriffsrechten, um antizipierte Rechtsverletzungen zu verhindern. Auch insoweit spricht das Schutzinteresse der Bevölkerung zunächst für Kompetenzausweitung der Gefahrenabwehrbehörden. Hier gilt es aber auch zu bedenken, dass die Exekutive weitgehend nicht die Rechtskunde hat, wie sie der Judikative zu unterstellen ist.
5.3 Eingriffe in die Demonstrationsfreiheit
Bei den Herausforderungen durch die sog. Querdenker, aber auch bei den Aktionen der sog. Klimaaktivisten – insbesondere bei der Beendigung der Großdemonstration in Lützerath – ist insbesondere das Demonstrationsrecht kritisch aufgegriffen worden. Dieses basiert ebenfalls auf unserer Verfassung. Dabei sollte nicht in Vergessenheit geraten, dass Demonstrationen die deutsche Wiedervereinigung maßgeblich vorbereitet haben. Maßnahmen dagegen müssen also mit Bedacht erfolgen, auch wenn solche Aktivitäten in der Bevölkerung mit einer Störung des Gemeinwesens in unterschiedlich starkem Umfang einhergehen und oft auf das Unverständnis in der Bevölkerung stoßen. So haben auch die gerichtlichen Korrekturen der Corona-Maßnahmen belegt, dass in diversen Fällen vornehmlich sog. Allgemeinverfügungen rechtswidrig waren. Nicht zu vergessen ist angesichts der beschriebenen Herausforderungen, dass die Exekutive grundsätzlich ermächtigt ist, durch sog. Allgemeinverfügungen Gefahrenabwehr zu betreiben. Die konkreten Maßnahmen zur Auflösung von Versammlungen sind ebenfalls rechtsstaatlich zu prüfen.
5.4 Razzien
Der Vorgang um die sog. Reichsbürger zeigt einen möglichen Nutzen zur Gefahrenabwehr. Razzien haben aber auch bei den sog. Klimaaktivisten stattgefunden. Sie sind jeweils Eingriffe in das durch unsere Verfassung geschützte Recht auf sog. Unversehrtheit der Wohnung sowie des Eigentums. Beispielhaft sei auf § 41 PolG NRW „Betreten und Durchsuchen von Wohnungen“ verwiesen: „Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers durchsuchen, wenn 1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die nach § 10 Abs. 3 vorgeführt oder nach § 35 in Gewahrsam genommen werden darf, 2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Sache befindet, die nach § 43 Nr. 1 sichergestellt werden darf, … 4. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist. … (3) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefahr jederzeit betreten werden, wenn „Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder ausüben, … .“ Bei denen Durchsuchungen im Zusammenhang mit „Letzte Generation“, „Gruppe um Lina E“ und „Reichsbürger“ war deshalb jeweils relevant, ob dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich war und/oder ob dort Straftaten geplant wurden. Die Gefahr einer willkürlichen Ausdehnung dieser Eingriffsrechte ist stets gegeben, dass die Begriffe „Annahme rechtfertigen“ und „Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforderlich“ subjektiven Spielraum zulassen und einer gerichtlichen Überprüfung als sog. Ermessensnormen nur eingeschränkt zulässig sind. Abzustufen ist aber jeweils das Vorgehen, wobei der „Letzten Generation“ insbesondere Nötigung, der Gruppe um Lina E insbesondere Körperverletzung, aber den Reichsbürgern sogar die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung vorgeworfen werden.
6. Abwägung bei demokratiekonformen Werten
Der erfolgte Bezug auf Art. 20 Abs. 4 GG zeigt, dass nach unserer Verfassung sogar private Gewaltanwendung bei Fehlen alternativer Handlungen legitim ist, wenn es darum geht, die staatliche Ordnung zu bewahren. „Widerstand“ wird also nicht per se abgelehnt und ist sogar verfassungsgemäß vorsehen. Basierend auf dieser Logik kann argumentiert werden, dass auch bei Wahl der Maßnahmen als Ausdruck der „Staatsgewalt“ stets abzuwägen ist, was Motivation ist.
In Ergänzung zu vorstehende Problembeschreibung und rechtlicher Übersicht, soll die Frage aufgeworfen werden, inwieweit eine aus demokratischer Sicht akzeptable ethische Grundhaltung ein unterschiedliches Vorgehen ermöglicht, beziehungsweise sogar unter sozialen Gesichtspunkten gebietet. Dabei ist der moderne Staat nicht als neutrales Wesen zu empfinden, sondern als Ergebnis der demokratischen Machtbildung. Deshalb kann von Bedeutung sein, ob ziviler Ungehorsam ethisch und sozial akzeptable Ziele verfolgt oder nicht. Konkret ist also zu argumentieren, dass staatliche Eingriffe stets auch in ethischer Hinsicht zu rechtfertigen sind und diese Regierungsziele sind das Bekämpfen rechtsextremer Strukturen und der Schutz der Umwelt. Ein solches Abwägen sollte jedenfalls verstärkt in die gesellschaftliche Diskussion einfließen, auch in die politische Bildung. Konsequenz könnte sein, dass staatliche Eingriffe weitaus weniger intensiv gerechtfertigt werden müssen, wenn es um in Ideologie und Umsetzung verfassungsfeindliche Gefährdungen geht, als wenn es um Gefahren geht, die zwar ideologisch mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung noch im Einklang stehen, aber deren Durchsetzung nicht akzeptabel erscheint. Folglich kann die These aufgestellt werden, wonach Staatsgewalt gegen staatsfeindliche Aktionen weitaus eher hinzunehmen ist, als gegen solche, die zwar nicht zu billigen, aber nicht verfassungswidrig sind.
7. Fazit
Die freiheitlich demokratische Grundordnung basiert auf Werteverständnis mit moralischem Standpunkt. Dies hat bei der Wahl der Mittel zum Schutz genau dieses Rechtsstaats einzufließen. Neben den Möglichkeiten, einer konkreten Gefahr zu begegnen, ergeben sich aus Maßnahmen, die bereits im Vorfeld Eingriffe rechtfertigen sollen, generell erhebliche Bedenken. Das Risiko staatlichen Machtmissbrauches ist zu groß, um weitreichend rein antizipierende Maßnahmen zu rechtfertigen. Zwar besteht durchaus ein Interesse, Gefahren frühzeitig abzuwenden, bevor sie sich konkretisieren, aber dies darf nicht über verfassungsrechtliche Grundprinzipien hinwegsehen lassen. Vergleichbar ist dies mit dem strafrechtlichen Grundsatz „in dubio pro reo“, also „im Zweifel für den Angeklagten“, wonach die Sorge vor Verurteilung Unschuldiger wichtiger ist, als das Begehren, keine Tat ungesühnt zu lassen. Faktisch sind Lebensabläufe nicht vorhersehbar, auch bei Indizien und Erfahrungswerten. Dies ist ein Dilemma jeder freiheitlichen Rechtsordnung, mit dem es umzugehen gilt, ohne verfassungsrechtliche Ziele aus dem Auge zu verlieren. Der Zweck „heiligt“ eben nicht jegliche Mittel.








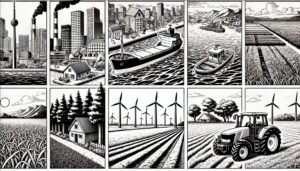
Historisch muss man hier auch auf die Spanische Republik der 1930er Jahre verweisen. Dort haben Bomben und Mord Anschläge z.B. Anarchistischer und Kommunistischer Gruppen auf Konservative und Kleriker dem Militär unter General Franco als Legitimation für den Militärputsch gegen die Demokratie gedient. Die Gewalt zwischen Links und Rechts Terroristen sowie die Unfähigkeit der Spanischen Republik das Gewaltmonopol im demokratischen Sinne sicherzustellen hat u.a zur Eskalation geführt die dann in den Spanischen Bürgerkrieg mit dem Sieg der Faschistischen Kräfte in der Diktatur geendet ist.
Es gibt also genug historische Beispiele die aufzeigen das die Alternativen zum demokratischen Verfassungsstaat alles andere als erstrebenswert sind.