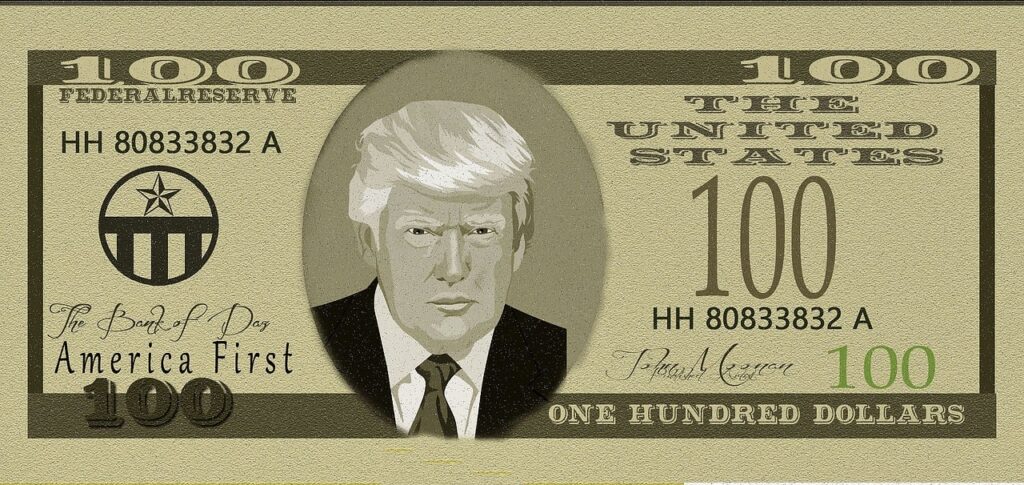

Gastbeitrag von Kai-Uwe Hülss M.A.
„Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt und das bin ich.“ Ein Satz, mit dem sich Guido Westerwelle über seinen frühen Tod hinaus doch irgendwie unsterblich machte. Seine Führungsqualitäten konnte der langjährige Bundesvorsitzende der Freien Demokraten in ein positives Bild rücken, als er seine Partei nach elfjähriger Abstinenz wieder in eine Regierungskoalition im zweiten Kabinett von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel führte. Westerwelles darauffolgendes Wirken am Werderschen Markt müssen indes Historiker beurteilen. Außenpolitisch stürmische Zeiten gab es schon damals. An den arabischen Frühling sowie an die Vorläufer des heutigen vollumfänglichen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sei erinnert. Was zu Beginn des zweiten Jahrzehnts in diesem Jahrtausend als Sturm begann, hat sich seitdem zu einem regelrechten Hurrikan mit Kriegen in Osteuropa und im Nahen Osten entwickelt. Der Kapitän der freien Welt, um in der metaphorischen Sprache Westerwelles zu bleiben, ist in so vielen Regionen sicherheitspolitisch gefordert wie nicht mehr seit Ende des Kalten Krieges. Welcher Politiker nach der US-Präsidentschaftswahl 2024 die 1600 Pennsylvania Avenue sein temporäres Zuhause und seinen zeitweisen Arbeitsplatz nennen darf, ist folglich nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika von Belang. Die am 05. November 2024 stattfindende Präsidentschaftswahl stellt auch Weichen für die Zukunft der Ukraine, Taiwans und der gesamten wertebasierten, demokratischen Welt. Die Vorwahlen beginnen am 15. Januar 2024 in Iowa, erfahren am 05. März 2024 am Super Tuesday ihren Höhepunkt und werden im Juni formal ihr Ende finden.
Vor diesem Hintergrund befasst sich der nachfolgende Beitrag mit den außen- und sicherheitspolitischen Auffassungen der vier aussichtsreichsten Teilnehmer der innerparteilichen Präsidentschaftsvorwahlen mit Fokus auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Joe Biden: Mit angezogener Handbremse im Einsatz für die Demokratie
Bidens Karriere
Im Jahr 2021 zog Joe Biden in das Weiße Haus im Alter von 78 Jahren ein. Kein anderer Politiker zuvor wurde in einem so hohen Alter erstmals in das Amt des US-Präsidenten gewählt. Gleichzeitig ist Biden der erste Präsident, der im Amt die 80er Jahresmarke überschritten hat. Infolgedessen wird er zunehmend mit alters- und gesundheitsbedingten Fragen konfrontiert. Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Präsident Biden so viel politische Erfahrung wie kaum ein anderer US-Politiker, zumal im gegenwärtigen Wahlkampf, aufweist.
Zwischen 1973 und 2009 amtierte Biden als U.S. Senator für Delaware. Dabei gehörte der Demokrat unter anderem dem Auswärtigen Ausschuss, teils als dessen Vorsitzender, an. Die Militärinterventionen in Afghanistan und im Irak befürwortete Biden, wenngleich er in der Rückschau seine Unterstützung für den Regimewechsel in Bagdad bereut. Unter Präsident Barack Obama diente Biden seinem Land acht Jahre als Vizepräsident. In dieser Position war Biden unter anderem für die Ukraine-Politik der Administration verantwortlich.
Bidens außenpolitische Bilanz
Als US-Präsident erbte Biden die von seinem Vorgänger beschlossenen Abzugspläne aus Afghanistan. Der darauffolgende von Präsident Biden verantwortete chaotische und mit den Verbündeten schlecht kommunizierte Abzug führte zu einem nachhaltigen Absturz seiner Zustimmungswerte in den USA, zu einem Vertrauensverlust unter befreundeten Staaten und zur Ermutigung autoritärer Länder und Terrororganisationen. Eine Ermutigung, die wohl auch der russische Präsident Vladimir Putin spürte, als sich sein US-amerikanischer Amtskollege ohne Vorbedingungen in Genf, Schweiz, mit ihm traf. Das Treffen verlief freilich ergebnislos, wertete den russischen Herrscher jedoch weltpolitisch unnötig auf. Es folgte Bidens Aufgabe des Widerstandes gegenüber dem Bau der Gaspipeline NordStream 2. Wenige Monate später, Russland verlegte schon seine Truppen an die Grenze zur Ukraine, sorgte Präsident Biden für Aufsehen, als er davon sprach, dass es kein Problem darstellen würde, wenn Russland „kleine Gebiete“ der Ukraine besetzen würde. Als die vollumfängliche russische Invasion der Ukraine unmittelbar bevorstand, versuchte Präsident Biden mit Sanktionsdrohungen den Kreml einzuschüchtern – eine naive Strategie und eine komplette Fehleinschätzung des historisch gewachsenen russischen Imperialismus. Die vermehrte Lieferung von militärischer Ausrüstung an die Ukraine schon vor Kriegsbeginn oder ähnliches hätte sicherlich abschreckender gewirkt. Seitdem versucht Präsident Biden aktiv eine Allianz der Demokratien gegen die Autokratien, schon vor Bidens Einzug in das Weiße Haus ein wichtiges Thema für ihn, zu schmieden. Die NATO erlebte hierdurch, ausgelöst durch den größten Angriffskrieg auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs, einen zweiten Frühling. Dank der Unterstützung der Länder der freien Welt unter Führung von Präsident Biden kann sich die Ukraine bislang gegen die russischen Invasoren verteidigen. Allerdings genehmigte Präsident Biden in den ersten beiden Kriegsjahren nur die Entsendung von militärischem Material, welches die Ukraine als souveränen Staat überleben lassen konnte, jedoch nicht die russischen Aggressoren vollständig aus dem Land hätte vertreiben können.
Bidens zukünftige Ukraine-Politik
Im Dezember 2023 rückte Präsident Biden leicht von der Ukraine ab. Bei einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymir Zelensky sprach Präsident Biden einerseits nur noch davon, die Ukraine so lange unterstützen zu wollen, „wie wir es können“. Zuvor sprach Präsident Biden immer davon, die Ukraine so lange unterstützen zu wollen, wie es nötig sei. Andererseits bedeute für Präsident Biden ein ukrainischer Sieg, dass das Land als souveräner Staat weiterbestehen könne. Heißt: Gebietsabtritte wären für den US-Präsidenten in Ordnung. Die Verantwortlichen in Washington D.C. werden, wie auch ihre Kollegen in Westeuropa, Müde ob des Krieges in Osteuropa. In den USA liegt dies neben dem laufenden Wahlkampf auch in der Geopolitik begründet. Europa wird nicht mehr als sicherheitspolitisch so bedeutend angesehen wie noch im Kalten Krieg. Die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts sehen die USA, darin sind sich Politiker beider großer Parteien einig, im pazifischen Raum. Bidens allgemeine außenpolitische Positionen kurz zusammengefasst Präsident Biden setzt sich für eine Stärkung der Demokratie im In- und Ausland ein. Dabei vertraut er multilateralen Organisationen. Die NATO erstarkte in seiner Amtszeit ebenso wie Bündnisse im Pazifik, das trilaterale Militärbündnis AUKUS zwischen Australien, Großbritannien und den USA sowie der Zusammenschluss zwischen den USA, Australien, Indien und Japan als Quad seien an dieser Stelle exemplarisch genannt. Zurückhaltende sicherheitspolitische Entscheidungen in Bezug auf die Ukraine oder neuerdings auch bezüglich dem Nahen Osten sind primär dem Einfluss zahlreicher Vertrauter von Obama, die schon in dessen Administration tätig waren, geschuldet.
Donald Trump: Erfinder der America First Doktrin des 21. Jahrhunderts
Trumps Karriere
Donald Trump wurde 1946 in New York City als Sohn eines regionalen Immobilienunternehmers geboren. Das Unternehmen seines Vaters expandierte Trump von den New Yorker Stadtteilen Brooklyn und Queens nach Manhattan, welche den Durchbruch für eine spätere landesweite Karriere legen sollte. Trump weiß sich zu inszenieren, die Schlagzeilen zu bestimmen. Schon als aufstrebender Immobilienmanager wusste er die Medien für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Trump erschuf damit den Mythos eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Bis in nahezu jeden US-amerikanischen Haushalt wurde dieses Bild transportiert, als er auf NBC den Gastgeber der TV-Show „The Apprentice“ („Der Lehrling“) für 14 Staffeln mimte. Medien und Trump profitierten spätestens zu diesem Zeitpunkt gegenseitig voneinander. Als Trump im Jahr 2015 aktiv in die Politik einstieg, änderte sich an diesem Prinzip nichts. Medien berichteten ohne Unterbrechung über Trump – im positiven wie im negativen Sinne.
Trumps außenpolitische Bilanz
Infolgedessen ist es nicht verwunderlich, dass Trumps Worte oftmals nicht mit dessen expliziten Taten übereinstimmen. Wichtig ist für Trump allein, den Diskurs zu bestimmen, Stimmungen zu beeinflussen. Zuletzt nannte er die islamistische Terrororganisation Hamas „smart“ – im Weißen Haus war Trump jedoch der Israel am freundlichsten gesinnte US-Präsident seit Jahrzehnten. Dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un drohte er mit „Feuer, Wut und Macht“ – nur um sich wenig später mit dem dritten Anführer der Kim-Dynastie zu bilateralen Gesprächen zu treffen. Gegenüber dem Mullah-Regime im Iran fand Trump ebenso harsche Worte – sah jedoch von einem Vergeltungsschlag gegen den Iran ab, nachdem dieser eine US-Drohne abschoss. Eine Vorgehensweise, die auch bei Trumps Beziehung mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin beobachtet werden konnte. Einerseits fand Trump für den Kreml-Despoten lobende Worte, seinen eigenen Geheimdienst konterkarierte Trump während einer Pressekonferenz mit Putin öffentlich. Andererseits verabschiedete die Trump-Administration laut der Brookings Institution die bis dahin stärksten Sanktionen gegen die Russische Föderation.
Trumps zukünftige Ukraine-Politik
Seit seinem Bestseller The Art of the Deal aus dem Jahr 1987 genießt Trump den Ruf eines Geschäftemachers mit dem Talent, Vereinbarungen zu seinem Vorteil treffen zu können. Ein angebliches Talent, mit dem Trump auch bei der Lösung des Ukraine-Krieges prahlt: Laut eigener Aussage würde er es nämlich schaffen den „Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden“. Um dies zu erreichen brachte Trump Gebietsabtretungen von Seiten der Ukraine ins Spiel, da nach seiner Aussage ja ohnehin schon „russischsprachige Gebiete“ existieren würden. Die US-Hilfen für die Ukraine sieht Trump infolgedessen sehr skeptisch. Diese würden den Krieg vielmehr verlängern und noch weitere Opfer fordern. Gegenüber europäischen Hilfen für die Ukraine hat Trump jedoch nichts einzuwenden. Für die Entscheidung von Präsident Biden, Streumunition an die Ukraine zu liefern, fand Trump kritische Worte: „Biden führt uns mit der Lieferung von Streumunition in den Dritten Weltkrieg.“ Die Gefahr des russischen Imperialismus für die USA und den Weltfrieden erkennt Trump indes nicht.
Trumps allgemeine außenpolitische Positionen kurz zusammengefasst
Im Gegensatz zu Präsident Biden sieht Trump multilaterale Bündnisse skeptisch. Internationale Organisationen stellen für ihn kaum einen Mehrwert dar, primär kurzsichtige ökonomische Interessen räumt Trump eine weitaus gewichtigere Rolle ein als langfristige strategische Ausrichtungen. Der 45. US-Präsident bevorzugt, wie er auch in seiner Amtszeit unter Beweis stellte, bilaterale Abkommen. Offenbar fühlt sich Trump, wie einst als Immobilienmogul, in Verhandlungen mit nur einem Partner wohler. Dabei steht er Gesprächen zu allen Amtskollegen, ob demokratisch gewählt oder autoritär, offen gegenüber. Militärischen Interventionen steht Trump skeptisch gegenüber. Auf Grund seiner Rhetorik und Unberechenbarkeit stellt Trump für Verbündete wie Feinde gleichermaßen eine Herausforderung dar.
Nikki Haley: Vertreterin eines klassischen Konservatismus
Haleys Karriere
Im Jahr 1972 erblickte Nikki Haley als Nimrata Nikki Randhawa in Bamberg, South Carolina, als Tocher indischer Einwanderer das Licht der Welt. Die Familie integrierte sich ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Für das Unternehmen ihrer Eltern erledigte Haley schon mit dem 13. Lebensjahr die Buchführung, ein Studium in diesem Fachbereich an der Clemson University folgte. Ihre politische Karriere begann Haley im Jahr 2005, als sie erstmals dem Staatsparlament von South Carolina als Abgeordnete angehörte. Im Jahr 2010 folgte Haleys Wahl zur Gouverneurin. Zur Verwunderung vieler politischer Beobachter schloss sich die damals noch als Gouverneurin amtierende Haley der Trump-Administration an. Zwischen 2017 und 2018 diente Haley ihrem Land als Botschafterin bei den Vereinten Nationen und konnte dabei wertvolle außenpolitische Erfahrungen sammeln. In dieser Position unterstützte und bewarb sie unter anderem den Ausstieg der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat und aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Die Sanktionen gegen Russland in Folge der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Krim verteidigte Haley bei den Vereinten Nationen öffentlichkeitswirksam.
Haleys zukünftige Ukraine-Politik
Haley betont, dass die Ukraine in ihrem Freiheitskampf unterstützt werden müsse. Generell gelte es, so Haley, der Tyrannei weltweit Einhalt zu gebieten: „Was wir verstehen müssen ist, dass ein Sieg für die Ukraine ein Sieg für uns alle ist.“ Haley plädiert dafür gemeinsam mit Verbündeten der Ukraine weiterhin militärische Ausrüstung und Munition zur Verfügung zu stellen. Laut Haley stehe die Entsendung eigener Truppen nicht zur Debatte. Des Weiteren ist Haley der Meinung, dass ein Sieg der Ukraine auch eine Botschaft an die autoritär regierten Länder China, Iran und Nordkorea wäre.
Haleys allgemeine außenpolitische Positionen kurz zusammengefasst
Haley vertritt in der Außen- und Sicherheitspolitik klassische republikanische Werte, die auf Präsident Ronald Reagan zurückgehen. Demnach müssten die USA die freie Welt anführen, Frieden könnte nur durch eigene Stärke erreicht werden. Militärinterventionen im Ausland schließt Haley generell nicht aus, gleichwohl nicht im Fall des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Internationalen Organisationen steht Haley offen gegenüber – diese sollten jedoch reformiert werden, um für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts funktionsfähig zu sein.
Ron DeSantis: Konservativere Trump-Kopie ohne Charme
DeSantis’ Karriere
Ron DeSantis gehört zu den außen- und sicherheitspolitisch unerfahrensten Präsidentschaftskandidaten. Dabei diente DeSantis zwischen 2005 und 2010 in der Rechtsabteilung der U.S. Navy, davon neun Monate im Irak. Seine politische Karriere richtete DeSantis, der erstmals 2013 in das U.S. Repräsentantenhaus gewählt wurde, nämlich ganz auf wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen aus. Als Gouverneur von Florida, dem Sunshine State steht DeSantis seit 2019 vor, machte sich der Jurist als Kulturkämpfer in der schon seit Jahrzehnten sich forcierenden Auseinandersetzung zwischen konservativem und linksliberalem Amerika einen Namen. Mit dieser Bilanz versucht DeSantis auch im republikanischen Präsidentschaftsvorwahlkampf primär zu punkten. Dabei positioniert sich DeSantis als wählbarere und mit seinen 45 Jahren weitaus jüngere Alternative zu Trump, ohne jedoch dessen Charme zu besitzen.
DeSantis’ zukünftige Ukraine-Politik
Einerseits sieht DeSantis die US-Hilfen für die Ukraine skeptisch, da es laut des Gouverneurs ohnehin „nur um einen territorialen Disput zwischen der Ukraine und Russland“ gehen würde. Folglich, so DeSantis, hätten die USA in der Ukraine keine „vitalen nationalen Interessen“. Vielmehr sollten sich die USA auf die Probleme im eigenen Land, wie dem Drogenmissbrauch, konzentrieren. Andererseits nannte DeSantis den russischen Diktator Putin auch schon einen Kriegsverbrecher. Die russische Invasion der Ukraine 2022 bezeichnete DeSantis ebenso als einen Fehler wie die Annektierung der Krim 2014. Seine skeptische, aber inkonsistente Haltung unterstrich DeSantis in einem Interview mit CNN, als er das eigentlich hehre Ziel eines „nachhaltigen Friedens in Europa, welcher Aggression nicht belohnt“ formulierte. Doch ohne die US-Hilfen für die Ukraine dürfte dies kaum gelingen.
DeSantis’ allgemeine außenpolitische Positionen kurz zusammengefasst
DeSantis fiel im Vorwahlkampf zunächst nicht mit außenpolitischen Positionen auf. Wahlkämpfe werden in den USA ohnehin in der Regel mit innenpolitischen Themen entschieden. Andererseits hatte DeSantis auch noch keine außenpolitische Agenda für sich entwickelt – und stolperte damit von einem Fettnäpfchen in das andere. Nach knapp einem Jahr Vorwahlkampf scheint jedoch klar zu sein, dass DeSantis für eine Art Isolationismus steht, der beispielsweise die Ukraine nicht weiter unterstützen und weitaus mehr Anstrengungen verbündeter Staaten verlangen würde als dies oben genannte Kandidaten ohnehin schon tun beziehungsweise planen. Insgesamt ist DeSantis’ außenpolitische Einstellung weiterhin ein Buch mit sieben Siegeln.
Fazit: Europa muss Erwachsen werden, USA schauen gen Pazifik
Egal ob Präsident Biden nach der Präsidentschaftswahl mit Westerwelles Worten „Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt und das bin ich – jetzt nicht mehr“ vom Weißen Haus Abschied nimmt oder nicht, Europa wird künftig noch mehr Eigenverantwortung tragen müssen. Bekanntlich wenden sich die USA ja schon seit der Ära Obama von Europa ab. Bis zum heutigen Tag sind dieser Erkenntnis in Europa kaum mehr als Absichtsbekundungen gefolgt – auch zum Leidwesen der Ukraine. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sehen die Vereinigten Staaten parteiübergreifend im Pazifik. Eine Region, in dem sich der Systemwettbewerb zwischen dem kommunistischen, autoritären China und den demokratischen, liberalen USA entscheiden wird. Eine Region, in dem eine noch viel größere militärische Auseinandersetzung, als dies ohnehin schon in Osteuropa der Fall ist, droht. Eine Begebenheit, in der sich die vier auf einen Wahlsieg im November erfolgversprechendsten Präsidentschaftskandidaten einig sind.
Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wird in der Regel die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter.
Kai-Uwe Hülss M.A.
“Kai-Uwe Hülss ist Politikwissenschaftler und Soziologe mit den Schwerpunkten in politischer und gesellschaftlicher Kultur, Demokratieforschung sowie der Ökonomie. Studium an der Georg-August-Universität Göttingen, Universität Rostock und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Mit “1600 Pennsylvania“ versucht er in polarisierenden Zeiten tiefgehend, unaufgeregt und differenziert über US-Politik zu informieren und diese zu analysieren.“








