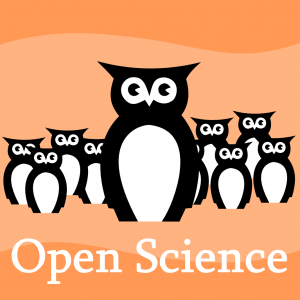
Open Sciene - Öffentliche Wissenschaft | Vorläufiges Logo, CC-BY-NC-SA Oliver Tacke
Gastbeitrag von Oliver Tacke, Pirat und Vortragender auf der 2. Openmind

Das kleine Wörtchen Open kann man ja vor so mancherlei Begriff setzen und ihm damit eine interessante Wendung geben. Wir kennen Open Government und verstehen darunter so etwas wie eine transparente Regierungsart, bei der Bürger stärker als bisher an den politischen Prozessen teilhaben können. Es gibt außerdem Open Access, Open Source, und so weiter und so fort, die verwandte und weitere typische Merkmale wie freien Zugang aufweisen. Ich persönlich warte ja noch immer auf Open Nutella. Ein Bereich, bei dem der kleine Zusatz zwar schon eine ganze Weile existiert, aber dennoch weitgehend unbekannt ist, ist die Wissenschaft – es gibt jedenfalls keinen deutschen Eintrag in der Wikipedia und der englische ist sehr dürftig. Was mit öffentlicher Wissenschaft (Open Science) gemeint sein kann, soll dieser kurze Beitrag überblicksartig beleuchten.
Beginnen wir zunächst einmal mit dem hinteren Teil des Begriffs: der Wissenschaft. Was das ist und ausmacht, darüber haben sich belesenere Leute als ich schon viele Gedanken gemacht und bändeweise Bücher gefüllt. Für mich bedeutet Wissenschaft, ganz einfach gefasst, systematisch Unbekanntes zu entdecken und die eigenen Erkenntnisse weiterzugeben; mit anderen Worten: Forschung und Lehre. Und zwar im guten alten humboldtschen Sinne. Nicht so, wie er vielfach ausgelegt wird, in weitgehend einsamen Forschen und danach Andere belehren, sondern als verschränkter Prozess, an dem mehrere teilhaben. Das soll nicht heißen, alles müsse stets gemeinsam mit anderen ergründet werden, man dürfe sich nicht auch mal ins stille Kämmerlein zurückziehen und in Ruhe über einer Idee grübeln. Im Gegenteil, das ist wichtig. Was ich sagen will ist aber, dass Wissenschaft immer stärker auf die Ideen Vieler angewiesen zu sein scheint. Dass man besser vorankommt, wenn man seine Gedanken anderen mitteilt, Rückmeldungen dazu erhält und so möglicherweise auf die Lösung eines Rätsels stößt, die einem sonst entgangen wäre. Nichts anderes macht der Fernseharzt Dr. House, der trotz seines brillanten Geistes auf die Einfälle seines Teams angewiesen ist.
Höre ich Einwände? Das sind schließlich alles medizinische Experten, die sich mit hochkomplexen Problemen herumschlagen! Hochkompetente Spezialisten! Ganz genau. Und dennoch findet Dr. House am Ende einer Folge die Antwort zu seinem Problem oft in Unterhaltungen mit ganz normalen Menschen. Und in einer Episode, ohne Team, kommt er allein schlicht nicht weiter und diskutiert mit einem Hausmeister. Nun möchte ich das Beispiel aber nicht überstrapazieren. Es ist fiktiv und hinkt, wenn man es auseinanderpflückt. Aber es verdeutlicht die Grundidee, die hinter dem Gedanken der öffentlichen Wissenschaft steckt. Und nun kommen wir endlich zur Sache.
Hinter öffentlicher Wissenschaft steckte ursprünglich die Idee, zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft zu vermitteln. Erstere versteckte sich zu häufig in Elfenbeintürmen und kommunizierte über die Köpfe des gemeinen Volkes hinweg, letztere verstand nicht mehr, was in den Türmchen vor sich ging. Das Ziel war es daher, durch Popularisierung von Wissenschaft einer breiteren Bevölkerungsschicht die Erkenntnisse der Forschung näher zu bringen. Dazu gibt es heute ganz unterschiedliche Ansätze: Zeitschriften wie Spektrum der Wissenschaft, Fernsehsendungen wie Quarks und Co. oder alpha-Centauri, Science Centers wie das Mathematikum in Gießen oder das Phaeno in Wolfsburg, Kinderunis, und, und, und. Open Access und Open Educational Resources fallen auch in diese Kategorie.
Ich finde das alles großartig, aber diese Wege haben auch Grenzen. In der Wissenschaft gilt Popularisierung in einigen Kreisen leider als Schimpfwort. So fühlte sich offenbar der Physiker Martin Bojowald im Vorwort zu seinem Buch Zurück vor den Urknall dazu genötigt, sich dafür zu rechtfertigen – er kontert allerdings auch mit der Frage: “Doch was ist aller wissenschaftliche Fortschritt wert, wenn man ihn nicht vermitteln kann?” Andersherum scheint in der Bevölkerung das Verständnis für das, was an Universitäten und Forschungseinrichtungen vor sich geht, noch immer nur gering ausgeprägt zu sein. Das lässt sich am Unverständnis vieler Menschen über das feststellen, was Karl-Theodor zu Guttenberg mit seinem Plagiat angestellt hat – der hat doch nur ein bisschen gemogelt, macht doch jeder mal.
Das Problem scheint mir zu sein, dass zwar die fertigen Produkte mundgerecht präsentiert werden, es handelt sich aber oft um Einwegkommunikation, die vorgelagerten Prozesse zur Entstehung dieses Produkts bleiben weithin intransparent. Außenstehende können kaum nachvollziehen, wie sie entstanden sind, welche Überlegungen bei der Erstellung verfolgt und verworfen wurden, welche Klippen es zu umschiffen galt und auch welche Fehler dabei gemacht wurden. All das bleibt im Dunkeln. Auch diese Aspekte gehören jedoch zur Wissenschaft dazu und wenn man sie ausklammert, wird ein falsches Bild von ihr gezeichnet.
Wenn man etwas weiter denkt, kann öffentliche Wissenschaft daher auch bedeuten, den gesamten Prozess der Erarbeitung von Wissen offenzulegen: Angefangen bei der Ideenfindung bis hin zum Verbreiten der Ergebnisse und anschließender Diskussion. Jeder Interessierte, egal ob Hochklasseforscher, gestandener Praktiker oder begeisterter Amateur, könnte von Anfang an einbezogen werden und mitunter sogar teilhaben – schließlich sind oft auch alle von den Auswirkungen der Wissenschaft betroffen. Warum sollten etwa Sozialwissenschaftler nicht direkt mit denjenigen in Kontakt treten, deren Verhalten sie untersuchen? Oder Lehramtsstudierende mit Schülern? Noch interessanter würde es, wenn sich jemand einklinkt, der einen ganz anderen Erfahrungshintergrund hat. Einerseits könnten so Forscher und Lehrende von Perspektiven außerhalb ihres Horizonts profitieren, andererseits die Außenstehenden etwas lernen und auch Einblicke in für sie oft fremde Welten gewinnen.
Gerade das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten, um all das zu unterstützen, sei es mittels Brainstorming-Sessions in Etherpads, Diskussionen von Zwischenergebnissen in Blogs oder der Erarbeitung von Texten in Wikis. Ebenso können die Grenzen von Lehrveranstaltungen durchlässiger gestaltet werden, um einerseits Interessierten Teilhabe zu ermöglichen oder andererseits von deren Beiträgen zu profitieren, etwa in theorielastigen universitären Veranstaltungen vom Praktikerwissen. Es gibt bereits verschiedene Beispiele, in denen das erfolgreich angewendet wird; ich picke da (nicht ganz wahllos) den Heidelberger Professor Christian Spannagel heraus, der sowohl seine Lehre als auch seine Forschung in der beschriebenen Weise öffnet.

Trotz der interessanten Idee existieren jedoch auch noch zahlreiche Probleme und offene Fragen, etwa welche sozio-kulturellen Aspekte zu berücksichtigen sind, welche politisch-rechtlichen Hürden im Weg stehen oder welche technischen Mittel am besten geeignet wären und gegebenenfalls angepasst und organisatorisch eingebunden werden müssten. Gerade weil dort noch vieles im Unklaren steht, sehe ich ungeachtet der möglichen gesellschaftlichen wie individuellen Vorteile die öffentliche Wissenschaft nicht als unumstößliche Norm oder Dogma an, sondern als pragmatisch zu verwendenden Ansatz. Es obliegt den Wissenschaftlern zu entscheiden, in welchen Phasen der Wissenskonstruktion eine Öffnung stattfindet und in welchen eher klassisch gearbeitet wird. Schließlich muss auch das zur Situation und zur Persönlichkeit passen, sonst fruchtet es kaum.
Wer mehr über öffentliche Wissenschaft (und andere spannende Themen) erfahren möchte, ist herzlich zur 2. openmind-Konferenz eingeladen, die am 10. und 11. Oktober 2011 in Kassel stattfindet. Wer sich weiter über das Thema schlau machen möchte, dem seien als Einstieg die folgenden drei Werke ans Herz gelegt:
- Faulstich, Peter (2006): Öffentliche Wissenschaft, Bielefeld.
- Spannagel, Christian, Schimpf, Florian (2009): Öffentliche Seminare im Web 2.0, in: Apostolopoulos, Nicolas et al. (Hrsg.): Lernen im Digitalen Zeitalter, Berlin, S. 13-20.
- Tacke, Oliver (2010): Open Science 2.0: How Research and Education can benefit from Open Innovation and Web 2.0, in: Bastiaens, Theo J.; Baumöl, Ulrike; Krämer, Bernd J. (Hrsg.): On Collective Intelligence, Berlin, Heidelberg, S. 37-48.








