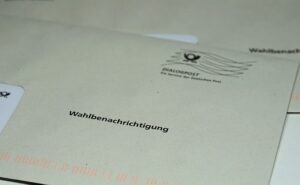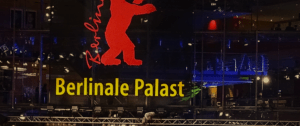Der Politik-Begriff ist komplex und mehrdimensional. Die politische Ideengeschichte reicht zurück bis ins Altertum. Legionen von Staatstheoretikern, manche unter ihnen zudem Staatslenker, haben bis in unsere Neuzeit hinein das Wesen der Politik feinsinnig zu ergründen und zu erklären versucht. Je nach Erfahrungshorizont und Denkrichtung werden mal diese, mal jene zu Säulenheiligen erhoben und andere dafür von ihren Podesten gestoßen.
Heute wirken die dichotomischen Weltbilder des 19. und 20. Jahrhunderts zwar immer noch bis in den Mikrokosmos der bundesdeutschen Kommunalpolitik nach. Ihr axiales Ordnungssystem mit seinem relativen Begriffspaar Links-Rechts vermag aber angesichts vielschichtiger Gemengelagen kaum noch hinreichende Orientierung, geschweige denn Anknüpfungspunkte für Handlungsoptionen zu geben. Weder die viel beschriebene Ochsentour durch Parteistrukturen oder ein politikwissenschaftliches Studium noch der Quereinstieg oder eine Kohorte an Politikberatern und Gutachtern sind in irgendeiner Weise Garanten für eine situationsbedingt adäquate Interessenvertretung. Ausgehend von einem veränderten Verständnis von Bürger und Staat und beschleunigt durch neue Kommunikationsmöglichkeiten bricht sich mit Verweis auf das grundgesetzlich garantierte Demokratieprinzip inzwischen eine Kritik Bahn, die die Statik des aktuellen Politiksystems infrage stellt und im Kern mehr Beteiligungsmöglichkeiten einfordert.
Die 25-jährige Marina Weisband zählt sich zu einer Generation, die mit dem bestehenden Politiksystem unzufrieden sei, weil es nicht zu ihrer Sozialisation, zu ihrer Kommunikation, zu ihrem Denken passe. Weisband selbst trat politisch unerfahren im September 2009 der Piratenpartei Deutschland bei, einer erst drei Jahre zuvor gegründeten basisdemokratischen Sammlungsbewegung, deren Kernanliegen ursprünglich Netzpolitik war und deren Mitglieder sich ehrenamtlich engagieren. Zunächst Beisitzerin im Münsteraner Kreisvorstand, wurde sie ohne Kenntnis von Aufgaben und Parteistrukturen im Mai 2011 unerwartet zur Politischen Geschäftsführerin im Bundesvorstand gewählt. Weisbands damalige Einstellung qualifiziert sie selbst als „naiv“ [Seite 48, im Folgenden wird nur noch die Seitenzahl genannt]. Der Wahlsieg bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September 2011 brachte jedoch einen Aufmerksamkeitsschub [vgl. 124] für die Piratenpartei im Allgemeinen und für Weisband alias @afelia im Besonderen, der die in Kiew geborene Psychologiestudentin zur medialen Gallionsfigur und zum Fixpunkt der PIRATEN machte, was sie aber auch bis zu ihrem regulären Ausscheiden im April 2012 finanziell und gesundheitlich überbeanspruchen sollte.
Während üblicherweise eher langjährig erfahrene Politikerinnen und Politiker sowie Elder Statesmen Sachbücher über den regulären Politikbetrieb publizieren, legt Weisband ihr Erstlingswerk bereits nach einem Lehrjahr in der Bundespolitik vor, denn unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit habe sie diese „anstrengende“ Erfahrung [130] den Blick richten lassen auf die gesellschaftliche Veränderung. Ihre „banales“ Postulat: Politik habe das Ziel, alle Menschen möglichst glücklich zu machen. Ihr Anspruch: „ein politisches Gesamtprojekt“ [88], bei dem alle Menschen sich das zur Teilhabe geeignete System aussuchen können, das sie in die Lage versetzt, „kluge Entscheidungen zu treffen“ [140]. In einer Welt, die ihrer Ansicht nach „verwirrt“ auf der Schwelle einer Veränderung stehe, müssten gerade junge Menschen politisch aktiv werden, weil sie „ohne Angst einfach hingehen und machen“ [173].
Anstatt noch weiter nach besseren Politikern zu suchen, empfiehlt Weisband „bessere Politik“ mittels „System, dessen Struktur möglichst effiziente, kontrollierbare und ehrliche Arbeit zulässt“ [64]. Dazu gehörten drei „Ebenen“: Feste Regeln, dynamische Prozesse/liquide Systeme und Transparenz.
Die „Spielregeln“, die bestimmten, wie viel Einfluss auf die Politik genommen werden könne, seien zum Zwecke der Anpassung an neue Bedürfnisse weiterzuentwickeln. [70] So sollten „Machteliten“ mittels niedrigschwelliger Beteiligungsmöglichkeiten [75] durch „Zeiteliten“ ersetzt werden. Liquide Demokratie, eine Mischform aus repräsentativer und direkter Demokratie, [78] könne mit der Möglichkeit der freien Stimmgewichtsdelegation zur neuen Form der Mitbestimmung werden, in dem das soziale Netzwerk der Bürger das Filtern und Bewerten übernähmen [95]. Außerdem könnten so „Menschen Politik machen, die inhaltlich fit sind, sich aber aus anderen Gründen gegen den Weg des Berufspolitikers entschieden haben“ [144]. Transparenz trage zur Orientierung, zur Offenlegung von politischer Arbeit [115] und zur Lösung von Problemen bei. Die Minimalforderung hier sei Partizipation, die Maximalforderung Nachvollziehbarkeit. [116] Um das zu erreichen, bedürfe es einer Veränderung „im Denken der gesamten Bevölkerung“ [145].
Zusammenfassend haben hier PIRATEN wie auch Kritiker allgemein verständlich und bündig die aktuell interessantesten Ansätze zur Modernisierung des Politikbetriebes. Weisband schafft sich zugleich Freiraum als „erwachsener“ Mensch [130] und setzt sich für Fehlertoleranz und „gute Kinderstube“ [151] gegenüber Mandatsträgern ein [vgl. 148].
Obgleich sich Weisbands Schrift flüssig liest, rufen einigen Passagen doch nach Erläuterungen oder zumindest Quellenangaben. Beispiel: Wann, wo und/oder wie haben sich denn wirklich „alle Parteien“ verpflichtet, einen Diskurs unter fairen Regeln aufrechtzuerhalten? [110] Weisband merkt zwar an, dass sie „nicht alles mit einer Fußnote bestücken“ [70] müsse, wohl aber „für jeden kleinen Bereich Leute kenne, die ihn sehr viel besser hätten beschreiben können“ [171]. Dennoch hülfen gelegentliche Konkretisierungen schon, die Ursprünge von Aussagen nachzuvollziehen.
Bei Pauschalisierungen könnten klare Ich-Botschaften den Eindruck mindern, hier erhebe jemand seinen jugendlichen Zeigefinger und gebe altersweise Tipps für revolutionär andere Managementmethoden. Das gilt insbesondere dann, wenn es darum geht, ein neues, allgemein verbindliches politisches System mit Erfahrungen aus Twitter und LiquidFeedback zu begründen. Außerdem finden sich in den Kapiteln dichotomische Einteilungen zuhauf: Einer gegen Viele, Jung gegen Alt, Laien gegen Experten, Frauen gegen Männer, analog gegen digital, Repräsentation gegen Mitbestimmung, „klassische hierarchische Machtstrukturen“ gegen Netzwerke. Bei aller Zustimmung im Detail hinterlassen solche Zuordnungen letztlich auch ein Geschmäckle. Beispielsweise sind längst nicht alle PIRATEN jung oder alle Vertreter des repräsentativen Systems Männer „mittleren Alters“ [91] „mit Bauch“ [107] – tatsächlich ist es öfter mal umgekehrt.
Gewiss gehört Marina Weisbands Schrift für jeden zur Primärliteratur, der sich mit dem Denken und Handeln sowohl jener befasst, die das politische System mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verändern wollen, als auch jener, die sich für die Piratenpartei eine Orientierung im Streit um Macht und Verantwortung wünschen oder (wieder) mehr Gewicht in der Netzpolitik erhoffen. Für basisdemokratisch orientierte PIRATEN jedoch ist der wachsende Kult um eine in den Mittelpunkt gerückte Leitfigur eher gewöhnungsbedürftig, der überbordende Medienhype um Weisbands Person sogar bizarr.
Parallel zum Abstieg der Piratenpartei in Umfragen und Wählergunst beeilen sich nachgerade alle bundesdeutschen Leitmedien von BILD und WELT über den SPIEGEL bis hin zur Süddeutschen Zeitung und Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit umfänglichen Stellungnahmen. Talkshow-Auftritte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei Beckmann, Illner und Lanz seien „gebucht“, der Auftritt auf der Leipziger Buchmesse selbstverständlich. Das kommt nicht von ungefähr, das ist professionelle PR – und damit schon eine andere Sphäre als jene von ihr beschriebene Zeit der Selbstorganisation – ohne Büro, ohne Referenten [vgl. 137].
Solange dabei noch politische Inhalte transportiert werden, dürften sich auch PIRATEN über die Aufmerksamkeit für ihre „politischen Positionen“ freuen [vgl. 134]. Andernfalls könnte Weisband das Schicksal vieler anderer „Promis“ teilen, die von „den Medien“ eine Zeit lang erst als Säulenheilige aufgebaut und gemolken wurden, um sie dann, wenn sie zu zäh geworden sind, zu grillen und jäh abstürzen zu lassen. Für eine auf Ikone setzende Piratenpartei bedeutete das den Blue Screen.
Weisband, Marina. Wir nennen es Politik: Ideen für eine zeitgemäße Demokratie. Stuttgart: Tropen (Klett-Cotta), 2013. 174 Seiten. 16,95 Euro, Kindle Edition 13,99 Euro. ISBN 978-3-608-50319-7