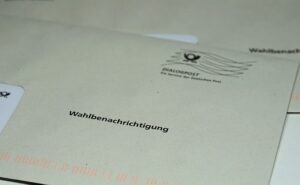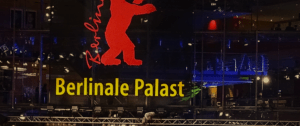FriedenspreisBuchmesse_CCBYSA_PeterOliverGreza

CC BY SA Peter Oliver Greza
Auf der Frankfurter Buchmesse wurde am Sonntag der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Der Preisträger stand von länger fest: der amerikanische Schriftsteller, Informatiker und Musiker Jaron Lanier. Der Börsenverein sieht ihn als “einen Pionier der digitalen Welt, der erkannt hat, welche Risiken diese für die freie Lebensgestaltung eines jeden Menschen birgt”.
Betitelt als “Vater des Begriffes der virtuellen Realität”, auf die Jaron große Stücke setzt, war er als Forscher an vielen Projekten der digitalen Welt beteiligt und leitet momentan als führender Wissenschaftler ein Studienprojekt zur Erforschung des “Internet 2”. Außerdem ist er als Forscher für Microsoft tätig.
Mit seinen Büchern “Gadget. Warum die Zukunft uns noch braucht” und “Wem gehört die Zukunft?” bezeichnet der Börsenverein ihn als einen der wichtigsten Kritiker der digitalen Entwicklung.
Die Ernennung wird nicht ohne Kritik gesehen. Die TAZ betrachtet die Vergabe des Friedenspreises an Jaron Lanier als verfehlt. “[…]Lanier [hat] das Internet so gründlich missverstanden wie kaum jemand anderes.” Das wahre Problem, das Lanier nicht sehen würde, bestünde darin, dass “das Sammeln von Daten und das Verwandeln von Aufmerksamkeit in Geld [das] Privileg einiger weniger geworden [ist].” (1)
Wie in Frankfurt aber deutlich wurde, hat er dieses Problem mindestens ebenfalls erkannt. Er sieht nicht nur die konzentrierte Macht des Wissens in wenigen Händen als problematisch an, sondern auch, dass die “Menschen den sozialen Netzwerken mehr vertrauen als den Regierungen”. Das liegt seiner Meinung nach unter anderem daran, dass ein großer Gegensatz zwischen der erzwungenen Sparsamkeit der Regierung und der Prosperität privater Unternehmen durch das Verkaufen privater Daten entsteht.
Weiterhin wird seiner Meinung nach eine andere Fehlentwicklung durch das geradezu wütende Sammeln von Daten heraufbeschworen: Eine Inkompetenz der Regierungen und Geheimdienste, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht. Als Beispiel nannte er die IS, die viel früher als Bedrohung hätte wahrgenommen werden müssen oder die Finanzskrise, für die das Gleiche gilt. Stattdessen hätten die Organe der Regierungen die Zeiten gesammelt, zu denen jeder einzelne aufs Klo geht. Dass hier etwas falsch läuft, ist wohl kaum zu übersehen.
Im Großen und Ganzen scheint Lanier entgegen der TAZ-Einschätzung nicht ganz so ignorant gegenüber der sozialen Entwicklung des Internets zu sein, wie die Zeitung angibt. Vielleicht hat er innerhalb eines Tages der Kritik ja dazugelernt. Jedenfalls einige der Probleme, deren mangelndes Interesse seinerseits Ulrich Gutmair kritisiert, scheint er ebenfalls erkannt zu haben. Natürlich kann man trotz allem mit der Entscheidung des Börsenvereins hadern, eine gewisse Berechtigung besteht aber in jedem Fall.